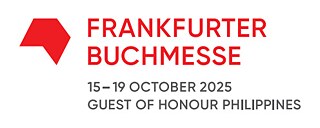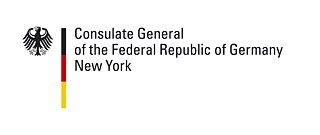Helen & Kurt Wolff Übersetzerpreis
Der in 1996 gegründete und aktuell von den Friends of Goethe New York finanzierte Preis zeichnet eine herausragende Literaturübersetzung vom Deutschen ins Englische aus, die im vorangegangenen Jahr in den USA veröffentlicht wurde. Preisträger*innen erhalten eine mit $5.000 dotierte Auszeichnung sowie eine finanzierte Reise zur Frankfurter Buchmesse vom 15.-19. Oktober 2025.
Bewerbungsverfahren
Verlage werden gebeten, herausragende Übersetzungen aus dem Deutschen ins Englische einzureichen, die im Vorjahr (2024) in den USA oder Kanada erschienen sind.
Übersetzer können sich nicht selbst bewerben, sondern müssen von ihren Verlagen nominiert werden.
Übersetzer können sich nicht selbst bewerben, sondern müssen von ihren Verlagen nominiert werden.
Amerikanische und kanadische Verlage sind eingeladen, eine im Vorjahr erschienene Buchübersetzung aus dem Deutschen ins Englische einzureichen.
Bitte senden Sie fünf physische Kopien der Übersetzung an die folgende Adresse:
Goethe-Institut New York
Helen & Kurt Wolff Translator's Prize
Attn: Dean Whiteside
30 Irving Place
New York, NY 10003
Einsendeschluss war der 17. Januar 2025. Bis zu diesem Datum müssen die Bücher eingegangen sein.
- Die Übersetzung muss im Jahr 2024 in den USA oder in Kanada publiziert worden sein.
- Eingereicht werden kann Prosa, d.h. Romane, Novellen, Kurzgeschichten sowie Dramen und Lyrik oder Sachliteratur wie Biographien, Essays oder Korrespondenzen.
- Übersetzer, die in den letzten sieben Jahren den Preis bereits gewonnen haben, sind vom diesjährigen Preis disqualifiziert.
Bitte senden Sie fünf physische Kopien der Übersetzung an die folgende Adresse:
Goethe-Institut New York
Helen & Kurt Wolff Translator's Prize
Attn: Dean Whiteside
30 Irving Place
New York, NY 10003
Einsendeschluss war der 17. Januar 2025. Bis zu diesem Datum müssen die Bücher eingegangen sein.
Die Preisträger*innen erhalten eine mit $5.000 dotierte Auszeichnung sowie eine finanzierte Reise zur Frankfurter Buchmesse vom 15.-19. Oktober 2025.
Die Preisträger*innen wird zur Preisverleihung nach New York eingeladen, die im Goethe-Institut New York stattfindet.
Die Preisträger*innen wird zur Preisverleihung nach New York eingeladen, die im Goethe-Institut New York stattfindet.
Shelley Frisch, Princeton, NJ (Vorsitzende)
Elisabeth Lauffer, Hannacroix, NY
Philip Boehm, Houston, TX
Elisabeth Lauffer, Hannacroix, NY
Philip Boehm, Houston, TX
Einreichungsfrist
Es werden keine weiteren Einreichungen für den Helen & Kurt Wolff Übersetzerpreis 2025 angenommen. Die Frist für die Einreichung einer vollständigen Bewerbung war der 17. Januar 2025.
Über die Wolffs und den Preis
Kurt Wolff, unterstützt von seiner Frau Helen, war einer der bedeutendsten Verleger Deutschlands in den 1920er Jahren. Helen und Kurt Wolff immigrierten 1941 nach New York und gründeten das Verlagshaus Pantheon Books, das sich überwiegend auf Übersetzungen deutscher sowie europäischer Literatur konzentrierte. Herman Broch, Stefan George und Robert Musil waren nur einige der Autoren, die sie verlegten. Im Jahr 1961 schloss sich das Ehepaar dem Verlagshaus Harcourt Brace Jovanovich an und etablierte ihr eigenes Verlagszeichen „Helen und Kurt Wolff Books“. Kurt Wolff starb am 21. Oktober 1963. Nach dem Tod ihres Mannes führte Helen Wolff die Geschäfte weiter und nahm noch weitere Autoren unter Vertrag, darunter: Karl Jasper, Walter Benjamin, Uwe Johnson, Günter Grass, Max Frisch, Jurek Becker, Hans Joachim Schädlich und viele andere.
Helen Wolff wurde mit dem Inter Nationes Award, der Goethe Medaille und mit den Ehrendoktorwürden von Mount Holyoke, Smith College und Dartmouth College für ihre Arbeit ausgezeichnet. Im Jahr 1994 erhielt sie den Friedrich Gundolf Preis von der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung, als Anerkennung ihres Beitrages, deutsche Kultur in den Vereinigten Staaten bekannt und deutsche Literatur einem amerikanischen Publikum zugänglich zu machen. Helen Wolff starb am 28. März 1994.
Helen Wolff wurde mit dem Inter Nationes Award, der Goethe Medaille und mit den Ehrendoktorwürden von Mount Holyoke, Smith College und Dartmouth College für ihre Arbeit ausgezeichnet. Im Jahr 1994 erhielt sie den Friedrich Gundolf Preis von der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung, als Anerkennung ihres Beitrages, deutsche Kultur in den Vereinigten Staaten bekannt und deutsche Literatur einem amerikanischen Publikum zugänglich zu machen. Helen Wolff starb am 28. März 1994.
Shelley Frisch, Juryvorsitz des Helen & Kurt Wolff Übersetzerpreises, über die 25-jährige Geschichte des Preises, seine Bedeutung für die Literaturübersetzung und das, was er für das besondere Vermächtnis bedeutet, das die Wolff Familie im Verlagswesen hinterlassen hat.
Von Shelley Frisch
Zu diesem feierlichen Anlass, dem 25. Jubiläum des Helen und Kurt Wolff Übersetzerpreises, ist es mir eine Ehre einige Gedanken zur Bedeutung dieses Preises für die Übersetzer*innen, die Literaturübersetzung und die Förderung der deutschsprachigen übersetzten Literatur in Nordamerika teilen zu dürfen. Ich bin seit 2015 Mitglied der Wolff Jury und habe seit 2016 ihren Vorsitz inne.
Was macht unseren Preis so einzigartig? Es handelt sich um deneinzigenPreis, der ausdrücklich und ausschließlich englischsprachige Übersetzungen deutscher Texte ehrt, die in den Vereinigten Staaten und Kanada veröffentlicht wurden. Anders als andere Übersetzerpreise, bei denen Texte verschiedener Ausgangssprachen vorgelegt und die Übersetzungskunst auf der Grundlage der Lesbarkeit des Zieltextes ausgezeichnet wird, geht es den Wolff Juror*innen darum, das deutschsprachige Original zu analysieren und die entsprechende Evolution des Zieltextes nachzuverfolgen. Die übersetzungstechnischen Herausforderungen des Ausgangstextes und das Gelingen der Transformation ins Englische stehen hierbei im Vordergrund. Unser Augenmerk richtet sich – nicht selten achtungsvoll – auf die genialen und erfinderischen Lösungen in Sachen Satzbau, Register, Rhythmus und Ton, die die gelungensten Übersetzungen beflügeln.
Seit der Gründung dieses Preises im Jahr 1996 fand sowohl ein geografischer Wandel – von Chicago, dem ursprünglichen Sitz, nach New York im Jahr 2015 – als auch eine Veränderung in der Juryzusammensetzung statt. Diese besteht aus Übersetzer*innen und Literaturkritiker*innen. In den ersten Jurys saßen typischerweise vier Männer und eine Frau, doch mit den Jahren wurde eine neue Balance hergestellt, so dass seit 2012 der Preis von einer Jury bestehend aus drei Frauen und zwei Männern verliehen wird. Kurz vor der Verleihung findet stets eine Plenarsitzung statt. Wie vieles in diesem Pandemiejahr musste auch das Jury-Treffen dieses Mal digital stattfinden.
Der Übersetzungssektor erlebt in den letzten Jahren einen Aufschwung durch neue Universitätsabschlüsse in den Translationswissenschaften, Zertifikatsprogramme und eine zunehmende Sichtbarkeit der Übersetzer*innen. Deren Namen taucht nun auch auf Buchdeckel, Webematerial und in den Rezensionen auf, ebenso spielen Translator*innen eine aktivere Rolle bei Buchpräsentationen und Podiumsdiskussionen. Helen und Kurt Wolff, die sich stark dafür engagiert haben, das Interesse an fremdsprachiger Literatur in den USA zu wecken und zu fördern, wären heute sehr froh über diese Wendung. Dieser Übersetzerpreis, der deren Namen trägt und vom Goethe-Institut veranstaltet wird, hat einen großen Beitrag geleistet, die Übersetzungsbranche zusammen zu bringen, hervorragenden Werken im Deutschen Aufmerksamkeit zu verschaffen und Übersetzungen und Übersetzer*innen ins Scheinwerferlicht zu rücken. Bei der Verleihung kommen die Jury, der Herausgeber des Gewinnertextes, das Team des Goethe-Instituts, Vertreter*innen anderer deutscher kultureller Einrichtungen, Mitglieder*innen aus den Medien und das interessierte Publikum zusammen, um die preisgekrönte Übersetzung sowie deren Verfasser*in zu würdigen – in einem feierlichen Rahmen, von guter Musik und einem Büffet untermalt. Dabei erlebt man stets diesen Moment der Ungezwungenheit nach den verschiedenen Lobreden, wenn schließlich die preisgekrönte Person vor dem Publikum mit einem Blumenstrauß erscheint und versucht, sich irgendwie von letzterem zu befreien um das Podium und/oder das vorbereitete Manuskript zu erreichen.
Ich möchte damit abschließen, dass ich persönlich meine Dankbarkeit gegenüber Helen und Kurt Wolff und deren Familie ausspreche. Ich habe Helen Wolff vor vielen Jahren in ihrem New Yorker Büro persönlich kennenlernen können und behalte unser Gespräch über die Verlagswelt und die Übersetzung in bester Erinnerung. Und Kurt Wolff spielt für mich eine ausragende Rolle als Kafka Herausgeber in Reiner Stachs dreibändige Kafka-Biographie, welche ich übersetzt und für die ich 2014 diesen Preis entgegennahm. Kafka reichte seine Texte immer nur sehr zögernd ein – nach seinem ersten Treffen mit Kurt Wolff schrieb er ihm: "Ich werde Ihnen immer viel dankbarer sein für die Rücksendung meiner Manuskripte als für deren Veröffentlichung." Wolff schaffte es nichtsdestotrotz aus Kafka Texte herauszukitzeln und so viele wie möglich herauszugeben. Sein Enkelsohn, Alexander Wolff, hat in seinem jüngsten WerkEndpaperseine mitreißende Darstellung der Familiengeschichte der Wolffs auf Papier gebracht. Dabei zollt er der Arbeit der Übersetzer*innen Tribut, insbesondere den Gewinner*innen des Wolff Preises. In der Bibliografie vonEndpapers, so Alexander, seien nicht weniger als acht Gewinner*innen des Helen und Kurt Wolff Übersetzerpreises vertreten. Ihnen spricht er herzlichen Dank für ihr Schaffen aus.
Kurt Wolff schrieb Karl Kraus im Jahr 1913 über die Aufgabe des Verlegers, dass diese mit einem "Seismographen" zu vergleichen sei, "der bemüht sein soll, Erdbeben sachlich zu registrieren. Ich will Äußerungen der Zeit, die ich vernehme, [...] notieren und vor die Öffentlichkeit zur Diskussion stellen." Unsere Jury, die Wolffs Namen trägt, verpflichtet sich, Helen und Kurt Wolffs Engagement in der Förderung der internationalen Literatur fortzuführen und seismographisch die herausragenden Übersetzungen großartiger Wortkünstler*innen dem breiten Leser*innenpublikum zu präsentieren.
--
Dr. Shelley Frisch lehrte an der Columbia University und am Haverford College, wo sie den Lehrstuhl für Deutsch innehatte, bevor sie sich in den 90ern auf Vollzeit der Übersetzungstätigkeit widmete. Ihre Übersetzungen aus dem Deutschen, darunter die Biographien von Friedrich Nietzsche, Albert Einstein und Franz Kafka wurden mit verschiedenen Übersetzerpreisen preisgekrönt. Zu ihren jüngsten Übersetzungen zählen: Billy Wilder on Assignment; Jena 1800: The Republic of Free Spirits; The Aphorisms of Franz Kafka und Adorno in Naples. Sie lebt in Princeton, New Jersey.
Übersetzung: Lucia Monti
Copyright: Shelley Frisch für Goethe-Institut New York
Juni 2021
Von Shelley Frisch
Zu diesem feierlichen Anlass, dem 25. Jubiläum des Helen und Kurt Wolff Übersetzerpreises, ist es mir eine Ehre einige Gedanken zur Bedeutung dieses Preises für die Übersetzer*innen, die Literaturübersetzung und die Förderung der deutschsprachigen übersetzten Literatur in Nordamerika teilen zu dürfen. Ich bin seit 2015 Mitglied der Wolff Jury und habe seit 2016 ihren Vorsitz inne.
Was macht unseren Preis so einzigartig? Es handelt sich um deneinzigenPreis, der ausdrücklich und ausschließlich englischsprachige Übersetzungen deutscher Texte ehrt, die in den Vereinigten Staaten und Kanada veröffentlicht wurden. Anders als andere Übersetzerpreise, bei denen Texte verschiedener Ausgangssprachen vorgelegt und die Übersetzungskunst auf der Grundlage der Lesbarkeit des Zieltextes ausgezeichnet wird, geht es den Wolff Juror*innen darum, das deutschsprachige Original zu analysieren und die entsprechende Evolution des Zieltextes nachzuverfolgen. Die übersetzungstechnischen Herausforderungen des Ausgangstextes und das Gelingen der Transformation ins Englische stehen hierbei im Vordergrund. Unser Augenmerk richtet sich – nicht selten achtungsvoll – auf die genialen und erfinderischen Lösungen in Sachen Satzbau, Register, Rhythmus und Ton, die die gelungensten Übersetzungen beflügeln.
Seit der Gründung dieses Preises im Jahr 1996 fand sowohl ein geografischer Wandel – von Chicago, dem ursprünglichen Sitz, nach New York im Jahr 2015 – als auch eine Veränderung in der Juryzusammensetzung statt. Diese besteht aus Übersetzer*innen und Literaturkritiker*innen. In den ersten Jurys saßen typischerweise vier Männer und eine Frau, doch mit den Jahren wurde eine neue Balance hergestellt, so dass seit 2012 der Preis von einer Jury bestehend aus drei Frauen und zwei Männern verliehen wird. Kurz vor der Verleihung findet stets eine Plenarsitzung statt. Wie vieles in diesem Pandemiejahr musste auch das Jury-Treffen dieses Mal digital stattfinden.
Der Übersetzungssektor erlebt in den letzten Jahren einen Aufschwung durch neue Universitätsabschlüsse in den Translationswissenschaften, Zertifikatsprogramme und eine zunehmende Sichtbarkeit der Übersetzer*innen. Deren Namen taucht nun auch auf Buchdeckel, Webematerial und in den Rezensionen auf, ebenso spielen Translator*innen eine aktivere Rolle bei Buchpräsentationen und Podiumsdiskussionen. Helen und Kurt Wolff, die sich stark dafür engagiert haben, das Interesse an fremdsprachiger Literatur in den USA zu wecken und zu fördern, wären heute sehr froh über diese Wendung. Dieser Übersetzerpreis, der deren Namen trägt und vom Goethe-Institut veranstaltet wird, hat einen großen Beitrag geleistet, die Übersetzungsbranche zusammen zu bringen, hervorragenden Werken im Deutschen Aufmerksamkeit zu verschaffen und Übersetzungen und Übersetzer*innen ins Scheinwerferlicht zu rücken. Bei der Verleihung kommen die Jury, der Herausgeber des Gewinnertextes, das Team des Goethe-Instituts, Vertreter*innen anderer deutscher kultureller Einrichtungen, Mitglieder*innen aus den Medien und das interessierte Publikum zusammen, um die preisgekrönte Übersetzung sowie deren Verfasser*in zu würdigen – in einem feierlichen Rahmen, von guter Musik und einem Büffet untermalt. Dabei erlebt man stets diesen Moment der Ungezwungenheit nach den verschiedenen Lobreden, wenn schließlich die preisgekrönte Person vor dem Publikum mit einem Blumenstrauß erscheint und versucht, sich irgendwie von letzterem zu befreien um das Podium und/oder das vorbereitete Manuskript zu erreichen.
Ich möchte damit abschließen, dass ich persönlich meine Dankbarkeit gegenüber Helen und Kurt Wolff und deren Familie ausspreche. Ich habe Helen Wolff vor vielen Jahren in ihrem New Yorker Büro persönlich kennenlernen können und behalte unser Gespräch über die Verlagswelt und die Übersetzung in bester Erinnerung. Und Kurt Wolff spielt für mich eine ausragende Rolle als Kafka Herausgeber in Reiner Stachs dreibändige Kafka-Biographie, welche ich übersetzt und für die ich 2014 diesen Preis entgegennahm. Kafka reichte seine Texte immer nur sehr zögernd ein – nach seinem ersten Treffen mit Kurt Wolff schrieb er ihm: "Ich werde Ihnen immer viel dankbarer sein für die Rücksendung meiner Manuskripte als für deren Veröffentlichung." Wolff schaffte es nichtsdestotrotz aus Kafka Texte herauszukitzeln und so viele wie möglich herauszugeben. Sein Enkelsohn, Alexander Wolff, hat in seinem jüngsten WerkEndpaperseine mitreißende Darstellung der Familiengeschichte der Wolffs auf Papier gebracht. Dabei zollt er der Arbeit der Übersetzer*innen Tribut, insbesondere den Gewinner*innen des Wolff Preises. In der Bibliografie vonEndpapers, so Alexander, seien nicht weniger als acht Gewinner*innen des Helen und Kurt Wolff Übersetzerpreises vertreten. Ihnen spricht er herzlichen Dank für ihr Schaffen aus.
Kurt Wolff schrieb Karl Kraus im Jahr 1913 über die Aufgabe des Verlegers, dass diese mit einem "Seismographen" zu vergleichen sei, "der bemüht sein soll, Erdbeben sachlich zu registrieren. Ich will Äußerungen der Zeit, die ich vernehme, [...] notieren und vor die Öffentlichkeit zur Diskussion stellen." Unsere Jury, die Wolffs Namen trägt, verpflichtet sich, Helen und Kurt Wolffs Engagement in der Förderung der internationalen Literatur fortzuführen und seismographisch die herausragenden Übersetzungen großartiger Wortkünstler*innen dem breiten Leser*innenpublikum zu präsentieren.
--
Dr. Shelley Frisch lehrte an der Columbia University und am Haverford College, wo sie den Lehrstuhl für Deutsch innehatte, bevor sie sich in den 90ern auf Vollzeit der Übersetzungstätigkeit widmete. Ihre Übersetzungen aus dem Deutschen, darunter die Biographien von Friedrich Nietzsche, Albert Einstein und Franz Kafka wurden mit verschiedenen Übersetzerpreisen preisgekrönt. Zu ihren jüngsten Übersetzungen zählen: Billy Wilder on Assignment; Jena 1800: The Republic of Free Spirits; The Aphorisms of Franz Kafka und Adorno in Naples. Sie lebt in Princeton, New Jersey.
Übersetzung: Lucia Monti
Copyright: Shelley Frisch für Goethe-Institut New York
Juni 2021
Alexander Wolff, Enkelsohn von Kurt Wolff und Autor von Endpapers: A Family Story of Books, War, Escape, and Home veranschaulicht in seinem Werk das stetige Bestreben des Großvaters, sich als Verleger auf beiden Seiten des Atlantiks zu behaupten.
Von Alexander Wolff
Kurt Wolff lebte lange und mutig genug, damit seine Laufbahn als Verleger in Deutschland und in den Vereinigten Staaten zwei ganze Zyklen mit Höhen- und Tiefpunkten erleben konnte.
Die beruflichen Erfolge meines Großvaters sind eng mit den dramatischen Wendungen der Geschichte des 20. Jahrhunderts verbunden. 1913 gründete er im Alter von 25 Jahren den Kurt Wolff Verlag in Leipzig. Das Haus rückte die Stimmen von das Neue – Schriftsteller die bereit waren, die engstirnige Kultur der untergehenden Monarchien Europas zu verspotten – in den Vordergrund. Darunter zählten Franz Kafka, Karl Kraus, Franz Werfel, Joseph Roth und Heinrich Mann. Wie Deutschland tat sich auch der Kurt Wolff Verlag sehr schwer, nach dem Krieg wieder Fuß zu fassen – erst durch die Hyperinflation in der Weimarer Republik, dann durch das Aufstreben des Nationalsozialismus Ende der 20er Jahre.
Von mütterlicher Seite zählte Kurt zwar in mehreren Generationen bekehrte Juden, doch es waren seine "entarteten" Autor*innen, die das Dritte Reich missbilligte. Wenige Stunden nach dem Reichtagsbrand floh er aus Deutschland, um sich erst in London niederzulassen, wo er Helen Mosel heiratete, die seine lebenslange Gefährtin und Mitarbeiterin sein wird. Nach acht Jahren Exil durch Frankreich und Italien flohen Kurt und Helen im März 1941 dank der Hilfe von Varian Fry von Lissabon nach New York. Ende des Jahres gründeten sie Pantheon Books; der Verlag veröffentlichte die Übersetzungen der Werke von Stefan George, Hermann Broch und Robert Musil, sowie seinen den ersten Bestseller des Hauses –The Complete Grimms’ Fairy Tales – die komplette Sammlung der Märchen der Brüder Grimm.
Durch den Frieden kam auch Wohlstand in die USA, aber nicht für Pantheon: Der Verlag bevorzugte Mitte der Fünfziger weiterhin literarische statt kommerzieller Titel. Nur durch die stetige Unterstützung der Bollingen Foundation und Anne Morrow Lindberghs Bestseller Gift from the Sea (deutsch: Muscheln in meiner Hand), konnte sich das Haus über Wasser halten, bis 1958 Kurt und Helen die Rechte für Boris Pasternaks Doktor Schiwago ergattern konnten.
Im meinem Buch Endpapers erkläre ich, wie Doktor Schiwagos Erfolg ein zweischneidiges Schwert darstellte:
Kurt und Helen verlassen Pantheon und kehren nach Europa zurück. Doch mit der Ironie des Schicksals ist es lange nicht vorbei:
Mein Großvater erlebte einen letzten Erfolgsmoment. 1960 lud William Jovanovich, CEO von Harcourt, Brace & World Kurt und Helen ein, eine eigene Reihe unter der Schirmherrschaft von Harcourt zu erstellen. Schnell nahmen die Wolffs Günter Grass und weitere bedeutende europäische Autor*innen unter Vertrag. Nach knapp drei Jahren kam Kurt auf dem Weg zum Deutschen Literaturarchiv Marbach durch einen Unfall mit einem Lastwagen ums Leben. Helen kehrte nach New York zurück, wo sie die Helen und Kurt Wolff Buchreihe für weitere 30 Jahre fortführte und unter andrem Walter Benjamin, Max Frisch, Karl Jaspers, und Uwe Johnson herausgab.
Kurt konnte sich zu drei verschiedenen Zeitabschnitten als Verleger behaupten: in Deutschland vor der Nazizeit, in New York bis zum verlorenen Machtkampf in der Chefetage und in seinen letzten Lebensjahren gemeinsam mit Harcourt von der Schweiz aus. In all diesen Phasen handelte der "diskriminierendste Verleger des zwanzigsten Jahrhunderts" (New York Times Book Review) nach seinen eigenen Bedingungen, wie er selbst verdeutlichte: "Ich möchte nur Bücher herausgeben, für die ich mich auf meinem Sterbebett nicht schämen werde."
---
Alexander Wolff war 36 Jahre lang an der Sports Illustrated tätig. Er ist Autor bzw. Redakteur von neun Büchern, einschließlich des New York Times Bestsellers Raw Recruits und Big Game, Small World, ausgezeichnet von der New York Times als "bemerkenswertes Buch". Der frühere Ferris Professor of Journalism in Princeton lebt mit seiner Familie in Vermont.
Übersetzung: Lucia Monti
Copyright: Ausschnitte aus der deutschen Übersetzung von Alexander Wolffs Endpapers (Das Land meiner Väter. Die deutsch-amerikanische Geschichte meines Großvaters Kurt Wolff ist von Monika Köpfer übersetzt und ab Herbst 2021 im DuMont Verlag erhältlich). Abdruck mit freundlicher Genehmigung vom DuMont Verlag.
Juni 2021
Von Alexander Wolff
Kurt Wolff lebte lange und mutig genug, damit seine Laufbahn als Verleger in Deutschland und in den Vereinigten Staaten zwei ganze Zyklen mit Höhen- und Tiefpunkten erleben konnte.
Die beruflichen Erfolge meines Großvaters sind eng mit den dramatischen Wendungen der Geschichte des 20. Jahrhunderts verbunden. 1913 gründete er im Alter von 25 Jahren den Kurt Wolff Verlag in Leipzig. Das Haus rückte die Stimmen von das Neue – Schriftsteller die bereit waren, die engstirnige Kultur der untergehenden Monarchien Europas zu verspotten – in den Vordergrund. Darunter zählten Franz Kafka, Karl Kraus, Franz Werfel, Joseph Roth und Heinrich Mann. Wie Deutschland tat sich auch der Kurt Wolff Verlag sehr schwer, nach dem Krieg wieder Fuß zu fassen – erst durch die Hyperinflation in der Weimarer Republik, dann durch das Aufstreben des Nationalsozialismus Ende der 20er Jahre.
Von mütterlicher Seite zählte Kurt zwar in mehreren Generationen bekehrte Juden, doch es waren seine "entarteten" Autor*innen, die das Dritte Reich missbilligte. Wenige Stunden nach dem Reichtagsbrand floh er aus Deutschland, um sich erst in London niederzulassen, wo er Helen Mosel heiratete, die seine lebenslange Gefährtin und Mitarbeiterin sein wird. Nach acht Jahren Exil durch Frankreich und Italien flohen Kurt und Helen im März 1941 dank der Hilfe von Varian Fry von Lissabon nach New York. Ende des Jahres gründeten sie Pantheon Books; der Verlag veröffentlichte die Übersetzungen der Werke von Stefan George, Hermann Broch und Robert Musil, sowie seinen den ersten Bestseller des Hauses –The Complete Grimms’ Fairy Tales – die komplette Sammlung der Märchen der Brüder Grimm.
Durch den Frieden kam auch Wohlstand in die USA, aber nicht für Pantheon: Der Verlag bevorzugte Mitte der Fünfziger weiterhin literarische statt kommerzieller Titel. Nur durch die stetige Unterstützung der Bollingen Foundation und Anne Morrow Lindberghs Bestseller Gift from the Sea (deutsch: Muscheln in meiner Hand), konnte sich das Haus über Wasser halten, bis 1958 Kurt und Helen die Rechte für Boris Pasternaks Doktor Schiwago ergattern konnten.
Im meinem Buch Endpapers erkläre ich, wie Doktor Schiwagos Erfolg ein zweischneidiges Schwert darstellte:
"Mit einem Mal wurde Pantheon Books mit einem Geldregen überschüttet, und es ergaben sich reale neue Chancen für einen Verlag, der sich lange mit seiner spezifischen »Physiognomie« (wie Helen es nannte) zufriedengegeben hatte. Mittlerweile rissen sich amerikanische Verlage darum, Schulbücher an die einzelnen Schulbezirke zu verkaufen, die den Unterricht der Babyboomer-Generation bewältigen mussten. Dies führte dazu, dass sich die Wall Street zunehmend für die Buchbranche zu interessieren begann, was Verlagsfusionen und -übernahmen nach sich zog. Ehemals unabhängige Verlage waren plötzlich nur noch ein Segment eines Firmenkonglomerats, von dem man einen ordentlichen Beitrag zur Unternehmensbilanz erwartete. In diesem sich abzeichnenden Konflikt vertraten Kurt und Helen die idealistische Seite, sie waren der Ansicht, ein hoher literarischer Anspruch werde sich auf lange Sicht auszahlen. Aber Schabert und zwei gleichgesinnte Aufsichtsratsmitglieder wollten Pantheon Books moderner und kommerzieller ausrichten – und sie hatten die besseren Karten. Bittere Ironie: Ausgerechnet ein Bestseller, der dem Verlag in den Schoß gefallen war, weil man der Umsicht und Reputation Wolffs vertraut hatte, forcierte nun die Auseinandersetzung, bei der Kurt und Helen schließlich den Kürzeren zogen. Es war, als hätte die Geschichte den Weg vorgezeichnet. Der Kulturhistoriker Anthony Heilbut vergleicht deutsche Intellektuelle, die in die Vereinigten Staaten geflohen waren, mit den europäischen Hofjuden von einst, wie Kurts Vorfahr Salomon von Haber einer gewesen war. »Sie spielten eine seltsame, auf ungute Weise periphere Rolle«, schreibt Heilbut. »Ein wenig vergleichbar mit den Kammerjuden früherer Zeiten genossen sie in manchen Bereichen große Autorität und blieben in anderen verwundbar: In Europa wie in Amerika witterten sie Unruhe und Verrat.«"
Kurt und Helen verlassen Pantheon und kehren nach Europa zurück. Doch mit der Ironie des Schicksals ist es lange nicht vorbei:
"Gezwungen, sich den Lebensunterhalt in dem einzigen Metier zu verdienen, in dem er sich auskannte, tat er dies gegen alle Widerstände und mit feinem Gespür. Ironischerweise hatte Kurt vor dem Ersten Weltkrieg die Mitbewerber in seiner alten Heimat mit seinen »amerikanischen« Vermarktungspraktiken geärgert – farbenfrohe Einbände, günstige Preise, auffällige Anzeigen in Zeitungen und auf Kioskplakaten. Später dann ließ sein ganz in der Alten Welt verhafteter Wesenskern ihn mit der Geschäftskultur seiner neuen Heimat in Konflikt geraten. […]
Kurt sah keinen anderen Ausweg, als abermals zu fliehen – über den Ozean zurück nach Europa, wo er sich in der Schweiz niederließ, auf buchstäblich neutralem Terrain."
Kurt sah keinen anderen Ausweg, als abermals zu fliehen – über den Ozean zurück nach Europa, wo er sich in der Schweiz niederließ, auf buchstäblich neutralem Terrain."
Mein Großvater erlebte einen letzten Erfolgsmoment. 1960 lud William Jovanovich, CEO von Harcourt, Brace & World Kurt und Helen ein, eine eigene Reihe unter der Schirmherrschaft von Harcourt zu erstellen. Schnell nahmen die Wolffs Günter Grass und weitere bedeutende europäische Autor*innen unter Vertrag. Nach knapp drei Jahren kam Kurt auf dem Weg zum Deutschen Literaturarchiv Marbach durch einen Unfall mit einem Lastwagen ums Leben. Helen kehrte nach New York zurück, wo sie die Helen und Kurt Wolff Buchreihe für weitere 30 Jahre fortführte und unter andrem Walter Benjamin, Max Frisch, Karl Jaspers, und Uwe Johnson herausgab.
Kurt konnte sich zu drei verschiedenen Zeitabschnitten als Verleger behaupten: in Deutschland vor der Nazizeit, in New York bis zum verlorenen Machtkampf in der Chefetage und in seinen letzten Lebensjahren gemeinsam mit Harcourt von der Schweiz aus. In all diesen Phasen handelte der "diskriminierendste Verleger des zwanzigsten Jahrhunderts" (New York Times Book Review) nach seinen eigenen Bedingungen, wie er selbst verdeutlichte: "Ich möchte nur Bücher herausgeben, für die ich mich auf meinem Sterbebett nicht schämen werde."
---
Alexander Wolff war 36 Jahre lang an der Sports Illustrated tätig. Er ist Autor bzw. Redakteur von neun Büchern, einschließlich des New York Times Bestsellers Raw Recruits und Big Game, Small World, ausgezeichnet von der New York Times als "bemerkenswertes Buch". Der frühere Ferris Professor of Journalism in Princeton lebt mit seiner Familie in Vermont.
Übersetzung: Lucia Monti
Copyright: Ausschnitte aus der deutschen Übersetzung von Alexander Wolffs Endpapers (Das Land meiner Väter. Die deutsch-amerikanische Geschichte meines Großvaters Kurt Wolff ist von Monika Köpfer übersetzt und ab Herbst 2021 im DuMont Verlag erhältlich). Abdruck mit freundlicher Genehmigung vom DuMont Verlag.
Juni 2021
Kontakt
-

Dean Whiteside
Bibliotheks- u. Informationsprojektmanager
Goethe-Institut New York