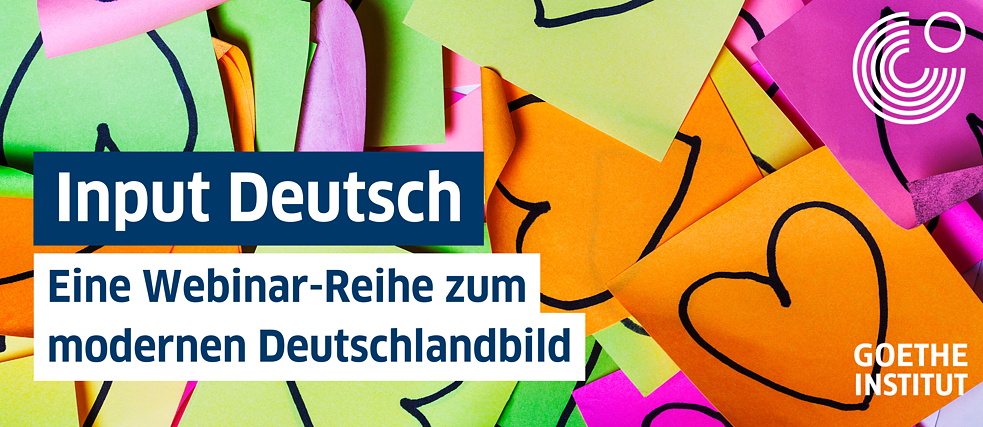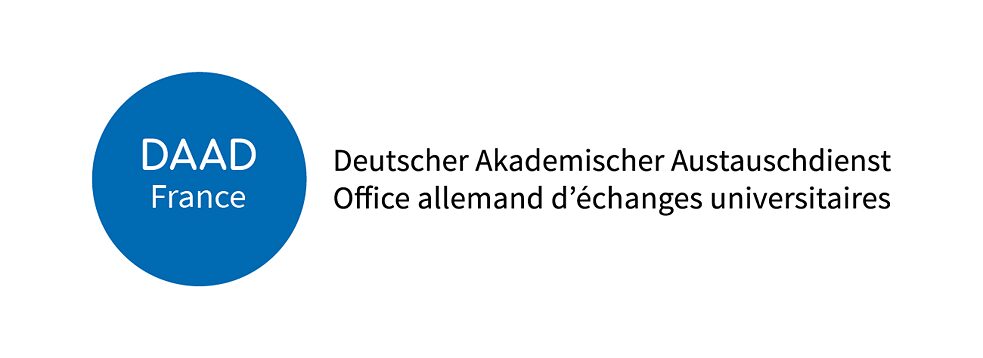Input Deutsch: Eine Webinar-Reihe zum modernen Deutschlandbild – mit den DAAD-Lektorinnen und Lektoren aus Frankreich
Für wen?
Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer in Frankreich sowie alle anderen Interessierten
Wann?
-Einmal pro Monat ab Januar 2025 (jedes Webinar kann einzeln und unabhängig von anderen besucht werden)
Kommende Termine:
- Montag, 13. Oktober 2025, 18.00 bis 19.00 Uhr MESZ
- Montag, 10. November 2025, 18.00 bis 19.00 Uhr MEZ
- Montag, 15. Dezember 2025, 18.00 bis 19.00 Uhr MEZ
Wo? Online auf ZOOM
Anmeldung: per Anmeldeformular
Sprache: Deutsch
Preis: kostenlos
Kontakt und Information: Britta.Nolte@goethe.de, +33 1 44 43 92 86
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte, ein Video zeigt mehr als tausend Bilder.
Jede Generation wächst mit einer anderen medialen Umgebung auf und wird dadurch unterschiedlich geprägt. Während sich die Generation Y mit Facebook begnügte, standen späteren Generationen Plattformen wie Instagram und Snapchat im Fokus. Heute dominiert TikTok: kurze Videos, die auf jeden noch so individuellen Geschmack zugeschnitten sind. TikTok ist längst ein globales Phänomen und macht auch vor den Schulhöfen nicht halt.
In diesem Input Deutsch beschäftigen wir uns mit den Grundlagen von TikTok: Wie funktioniert die Plattform, und was macht sie aus? Wir werfen einen Blick auf verschiedene (deutschsprachige) Trends wie #BookTok – TikTok für Bücherfans – und beleuchten die kritische Debatte rund um das umstrittene soziale Medium.
Jonas Meir lehrt als DAAD-Lektor an der Université Sorbonne Nouvelle. Ursprünglich hatte er vor seinem Lehramtsstudium den Plan, „irgendwas mit Medien“ zu machen – eine Orientierung, die wohl sein Forschungsinteresse für digitale Linguistik und Künstliche Intelligenz an der Schnittstelle zur Didaktik geprägt hat. Derzeit beschäftigt er sich besonders mit Schreibdidaktik im Kontext von KI (Large Language Models).

Das Thema Postmigration hat in den letzten Jahren im deutschsprachigen Raum an Bedeutung gewonnen. Mit der Neueröffnung des Berliner Ballhaus Naunynstraße begründete Shermin Langhoff 2008 das postmigrantische Theater, das die Wahrnehmung von Migration kritisch hinterfragt und zu einer neuen Rezeption von Migrationsgeschichten einlädt. Postmigration beschränkt sich nicht auf eine zweite oder dritte Generation von Migrant*innen, sondern umfasst auch die Idee einer postmigrantischen Gesellschaft (Naika Foroutan) oder eine postmigrantische Perspektive. Nicht nur im Theater, auch in Literatur, Film, Musik und Kunst werden postmigrantische Themen verhandelt. Postmigrantische Autor*innen wie Fatma Aydemir, Hengameh Yaghoobifarah oder Max Czollek plädieren für ein neues Verständnis von Gesellschaft und Migration, stellen kulturelle und nationale Homogenität in Frage, thematisieren Hierarchisierung, Marginalisierung und Rassismus. Wie lässt sich Postmigration aber didaktisch (in Frankreich) vermitteln? Und welche Maßnahmen können getroffen werden, um für eine postmigrantische Thematik zu sensibilisieren? Nach einer Einführung in das Thema soll es um diese Fragen gehen.
Martina Kopf ist DAAD-Lektorin an der Université de Caen Normandie. Nach einem deutsch-französischen Studiengang in Mainz und Dijon, promovierte sie mit einer komparatistischen Arbeit zu „Alpinismus-Andinismus. Gebirgslandschaften in europäischer und lateinamerikanischer Literatur“ (Metzler 2016). Sie lehrte und forschte viele Jahre in der Komparatistik an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Forschungsaufenthalte in Chile, Peru, Spanien, Harvard und in Paris mit einem Stipendium der Alexander von Humboldt-Stiftung. Derzeit forscht sie zu Postmigration in Frankreich und Deutschland (mit Marion Coste: Postmigration et postcolonialisme. Perspectives comparées sur les musiques et littératures francophones et germanophones. De Gruyter 2025). Mit Marion Coste hat sie verschiedene rencontres littéraires mit deutschsprachigen und frankophonen Autor*innen zum Thema Postmigration in der Maison Heinrich Heine organisiert.

Was bedeutet es eigentlich, „deutsch“ zu sein? Dieser ständig verwendete Begriff birgt viele Fragen und Kontroversen: Wer definiert ihn, wer erfüllt ihn, und wer wird ausgeschlossen? Dieses Webinar beleuchtet, wie der Deutschrap den Begriff des „Deutsch-Seins“ kritisch hinterfragt und neu interpretiert. Aus einer intersektionalen Perspektive werden Themen wie Rassismus, Geschlecht und Identität in aktuellen Werken verschiedener Künstler*innen analysiert. Dabei stehen die Aushandlungsprozesse von Zugehörigkeit und Ausschluss im Fokus, ebenso wie die alternativen Perspektiven, die dadurch auf „Deutsch-Sein“ sichtbar werden – ein Einblick in aktuelle gesellschaftliche Diskurse und ihre Herausforderungen.
Eileen Geißler ist aktuelle DAAD-Lektorin an der École normale supérieure. Sie setzt sich damit auseinander, wie Sprache Machtverhältnisse spiegelt und prägt. Ihre akademischen Interessen konzentrieren sich auf Fragen von Zugehörigkeit und Exklusion, die sie als eines der zentralen gesellschaftlichen Themen unserer Zeit betrachtet.

Kultur und Identität – zwei Begriffe, die uns in ihrem Facettenreichtum tagtäglich begegnen: Identitätsdarstellung auf Social Media, Kulturbegegnungen bei Nah- und Fernreisen, Identitätsbildung im Jugendalter, Ess- und Feierkultur, Identitätspolitik, Unternehmenskultur oder kulturelle Identität. Und auch in der deutschsprachigen Literatur spielen der Identitäts- und Kulturbegriff spätestens seit der Aufklärung eine zentrale Rolle. In Werken wie Lessings Nathan der Weise, Goethes Die Leiden des jungen Werther oder Kafkas Die Verwandlung stellen sie, teils in Wechselwirkung, zentrale Elemente dar.
In der Tradition der Literatur der Gegenwart erscheinen Kultur und Identität als ein ineinander verflochtenes, dynamisches und globales Konzept, in welchem Fragen nach Migration, Diversität und kultureller Identität im Mittelpunkt stehen. Anhand ausgewählter Beispiele der Gegenwartsliteratur soll die literarische Behandlung sowie Perzeption beider Elemente an diesem Abend betrachtet werden.
Isabella Jakubiak lehrt als DAAD-Lektorin an der Université Paris-Est Créteil im Fachbereich Deutsch als Fremdsprache. Nach Studium und Lehramtsreferendariat der Fächer Deutsch, Spanisch und Geschichte sowie langjähriger Tätigkeit als Lehrkraft für Deutsch als Fremdsprache in Spanien und Uruguay, war sie als Bereichsleiterin für Lehrkräftefortbildungen und Schüler*innenworkshops tätig. Derzeit beschäftigt sie sich im Rahmen ihrer Lehrveranstaltungen u.a. mit Paris als Zentrum bedeutender Schauplätze und Symbole der deutsch-französischen Geschichte und Beziehungen.

„Kann Humor heilen?“ – Diese Frage stand als Leitthema über der Arena-Tour 2017 der RebellComedy, einem Comedy-Ensemble aus Aachen. Die Frage lässt sich leicht umformulieren zu der folgenden: „Kann Humor bestärkende Wirkung entfalten angesichts sozialer Ausgrenzung und Diskriminierung?“
Um diese Frage nach den Zusammenhängen von Humor und Diskriminierung (insbesondere Rassismus und Sexismus) soll es im Webinar gehen. Inwiefern kann Komik und insbesondere (Stand-Up) Comedy als ein Instrument der Selbst-Repräsentation und Sichtbarmachung marginalisierter Gruppen und damit als eine Form des Empowerments aufgefasst werden können? In diesem Zusammenhang werden wir einen Blick auf die aktuelle Humor-Landschaft in Deutschland werfen.
Andrea Dassing ist als DAAD-Lektorin an der Université Rennes 2 tätig. Parallel dazu arbeitet sie an einer Dissertation zu Fluchtdiskursen in der medialen Rezeption des deutschen und französischen Gegenwartstheaters.
„Du bist zu sensibel“, wird es dem Rapper Tarek der Berliner Gruppe K.I.Z. vorgeworfen, als er seine Erfahrungen mit Diskriminierung und Rassismus in Deutschland thematisiert. Diese verarbeitet er im Song „Sensibel“ und prangert die Scheinheiligkeit einer vermeintlich offenen und toleranten Gesellschaft an, in der er sich als „Deutscher zweiter Klasse“ fühlt. Ähnliches ist auf Apsilons Album Haut wie Pelz (2024) zu hören: Im Lied „Koffer“ singt er beispielsweise von den abwertenden Blicken deutscher Mitbürger*innen, die ihn „wie Fäuste aus Metall“ treffen, wenn er mit seinen Freund*innen durch die Straßen von Berlin läuft.
Das Webinar befasst sich mit unterschiedlichen poetischen Verhandlungsformen und -strategien der Themen Alltagsrassismus, Migrantisierung und Integration im aktuellen Deutschrap. Dabei soll die Analyse von Liedtexten und Ausschnitten aus Musikvideos die Vielfalt der aktuellen Deutschrap-Szene beleuchten sowie Perspektiven für die Thematisierung im Unterricht von aktuellen gesellschaftlichen und politischen Diskursen eröffnen.
Moritz Schertl ist als DAAD-Lektor an der Université Rouen-Normandie tätig und verfasst gleichzeitig an der Universität Münster eine Dissertation zum Französischen Theater. Zu seinen Forschungsinteressen zählen die französische Literatur des 20. Jahrhunderts sowie der deutsche und frankophone Hip-Hop.
„Lachen ist gesund“ heißt es oft und entgegen des Vorurteils, das Deutschen oftmals begegnet, sind Menschen aus Deutschland durchaus humorvoll. Doch was ist überhaupt Humor und gibt es einen spezifisch „deutschen“ Humor? Dieser Frage versuchen wir uns mit Hilfe aktueller Beispiele zu nähern und betrachten dabei in Auszügen satirische Fernsehsendungen, Karikaturen, Sketche, populäre Produktionen von Streaming-Diensten, Postings von Influencer:innen und mehr. Abschließend werden Argumente für den Einsatz humoristischer Elemente im Sprachunterricht aus der Fachdidaktik diskutiert.
Marvin Kutz unterrichtet als DAAD-Lektor am Département d‘Allemand der Université de Lorraine in Metz. Nach dem Lehramtsstudium mit den Fächern Französisch und Evangelische Religionslehre absolvierte er parallel zu seinem Referendariat eine Weiterbildung im Bereich Deutsch als Fremdsprache. Im Rahmen des erfolgreichen Erwerbs des Staatsexamens für das Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen sammelte Marvin wertvolle Unterrichtserfahrung in Deutschland. Danach war er als Animateur für die Mobiklasse in der Region Occitanie tätig und unterrichtete parallel mit einer DAAD-Förderung an der Université Jean Jaurès (Toulouse II), bevor er dann die Stelle in Metz antrat. Weitere Auslandsaufenthalte im Rahmen seines Studiums führten ihn nach Versailles, Thessaloniki und Warschau.
Insbesondere bei der Arbeit mit jungen Schülerinnen und Schülern wurde dabei immer wieder klar, wie relevant Humor bei der Lehrtätigkeit ist.
Neben einem Forschungsprojekt im Bereich der Theologie sowie der französischen Literaturwissenschaft beschäftigt Marvin sich deshalb intensiv mit der Bedeutung von Humor für den Fremdsprachunterricht.

„Wenn Sie jetzt das Wort ‚Digga‘ benutzt, dann kannst du ja auf jeden Fall schon, äh, festnehmen, dass es keine potentielle Partnerin ist, weil du bist ein maskuliner Mann. Du möchtest eine feminine Frau. Und das ist genau das Gegenteil von feminin sein.“
Das schreibt der User Marcel im Internet unter ein Video der Rapperin Vita, die in einem ihrer Lieder das Wort „Digga“ benutzt. Es ist ein misogyner und sexistischer Kommentar, der mit Rollenklischees um sich wirft und Stereotype manifestiert. Glücklicherweise gibt es immer mehr KünstlerInnen und Aktivistinnen, die sich dieser Problematik annehmen, die Position beziehen, die nicht nur erklären, sondern aufklären und die jene Dinge aussprechen, die den einen peinlich sind, sie zu sagen und den anderen, sie zu hören.
Wir wollen uns anschauen, wie sich Frauen wie die Spiegel-Autorin und Influencerin Tara Louise Wittwer gegen Labels wie „Drama Queen“ (Name ihres Buches) wehren und internalisierte Misogynie aufdecken. In diesem Input geht es darum die Lebenswelt und die eigenen Erfahrungen der Schülerinnen im Hinblick auf (außer-)curriculare Inhalte wie Rollenklischees, Mobbing, körperliche Sexualisierung und Frauenfeindlichkeit anzuerkennen und anhand von Videos, Liedern und Texten an die Perspektive von SchülerInnen anzuknüpfen und eine Brücke zum deutschen Sprachraum zu schlagen.
Uns interessiert also nicht der Kommentar von Marcel, uns interessiert die Reaktion von Vita, die einen ganzen Song als Antwort auf Marcels Kommentar veröffentlicht hat, der es in sich hat!

Karneval ist neben dem Oktoberfest wohl das bekannteste traditionelle Fest in Deutschland, das weltweit für Schlagzeilen sorgt. Und das nicht ohne Grund: Karneval ist Kultur, Karneval ist Politik, Karneval ist Musik – Karneval ist Geschichte und Zukunft zugleich – Karneval ist aktueller denn je. Nicht ohne Grund steht der Kölner Karneval als Fest für Toleranz und Offenheit, die das Rheinland spätestens seit der Zuwanderung der sogenannten Gastarbeiter*innen verkörpert.
Insbesondere die Rheinische Karnevalskultur steht für einen „Beitrag zur Streitkultur“ wie es der Düsseldorfer Karnevalswagenbauer Jacques Tilly noch dieses Jahr in einem Interview mit der ZEIT formulierte. Kölsch, die einzige Mundart, die man auch trinken kann, ist Ausdruck der kölschen Mentalität und bedeutet u.a., dass jeder, egal, woher er einst in die Stadt am Rhein gekommen ist, dazugehört, gebraucht und geschätzt wird. "Mir sprechen hück all dieselbe Sprach, mir han dadurch so viel jewonne" , singt die Kölner Band Bläck Föös in ihrer Hymne auf die rheinische Toleranz, mit der es sich gerade im Deutschunterricht zu beschäftigen lohnt, weil sie für ein weltoffenes Deutschland steht.
In diesem Webinar soll vorgestellt werden, wie die breite Palette an Themen wie Heimat, Politik, Migration sowie die Erarbeitung eines regionalen Dialektes und weitere kulturelle und sogar historische Elemente ganz einfach anhand des Rheinischen Karnevals erarbeitet werden können. Das Ganze wird gekrönt von den schönsten Karnevalsliedern der Session und ein bisschen rheinischer Frohnatur, die in keinem Deutsch-Unterricht fehlen sollten.
Da simmer dabei, oder?
Rebekka Laouina-Hesse absolvierte ihr Lehramtsstudium in den Fächern Geschichte, Französisch und Italienisch an der Universität Leipzig, mit Aufenthalten in Lyon und Paris. Anschließend hat sie an der Université Meknès in Marokko und dann im Goethe-Institut Rabat als Lehrkraft und BKD/PASCH-Beauftragte gearbeitet. Derzeit ist Sie DAAD-Lektorin und Koordinatorin der Deutschabteilung am Campus Européen Franco-Allemand Sciences Po Paris in Nancy. Ihre Forschungsinteressen sind momentan vor allem der fächerübergreifende Unterricht sowie historische Themen der Frühen Neuzeit für eine anstehende Promotion im Fach Geschichte.

Ein Jahreswechsel ohne Silvesterraketen oder Böllerei? Für viele Menschen in Deutschland ist dies ein unvorstellbares Szenario. Schließlich bleiben das private Abfeuern farbenprächtiger Raketen und das Anzünden geräuschintensiver Böller in der Silvesternacht für sie ein liebgewonnenes Kulturgut, mit dem sie das neue Jahr freudig begrüßen. In der Regel haben sie in den Tagen „zwischen den Jahren“, also zwischen Weihnachten und Silvester, eine beachtliche Summe Geld für ihr privates Feuerwerksvergnügen ausgegeben. Auch wenn der Raketenspaß zu den Silvesterfeierlichkeiten an den meisten Orten Deutschlands friedlich verläuft, gibt es in jedem Jahr insbesondere aus den Großstädten Meldungen, die von Angriffen, starken Beschädigungen sowie zahlreichen Verletzten sprechen. Im letzten Jahr 2024 kosteten die unsachgemäße Verwendung und das Abfeuern so genannter „illegaler Feuerwerkskörper“ fünf Menschen das Leben. So wurde vor allem in den ersten Tagen dieses Jahres 2025 die Frage nach dem Sicherheitsrisiko an Silvester erneut gestellt. Die Kontroverse um ein allgemeines Raketen- und Böllerverbot für Privatpersonen wurde wieder entfacht.
Dieser Input Deutsch möchte den Teilnehmenden einen kompakten Überblick über die deutschen Silvestertraditionen rund um Feuerwerke aller Art geben, verschiedene Aspekte der „Böller-Kontroverse“ (Sicherheit, Umwelt, Tierschutz, Ökonomie) betrachten und didaktische Anregungen für eine Behandlung der Thematik im Deutschunterricht geben.
Julia Hammann lehrt als DAAD-Lektorin an der Université Paris Cité im Fachbereich Interkulturelle Studien und Deutsch als angewandte Fremdsprache. Nach dem Lehramtsstudium der Fächer Französisch, Katholische Religionslehre wie auch Geschichte und dem Referendariat arbeitete sie als Studienrätin an einem Gymnasium am Niederrhein. Ihre Schwerpunkte liegen in den Bereichen Heterogenität und Differenzierung sowie der Handlungsorientierung im Fremdsprachenunterricht.

Die Lehrpläne fordern einen Einzug kultureller und landeskundlicher Themen in den Deutschunterricht, die zudem Lernende begeistern und motivieren sowie ihnen Zugang zur deutschen Sprache verschaffen sollen. Oft greifen wir da auf klassische Themen (Zweiter Weltkrieg, geteiltes Deutschland, Berliner Mauer…) zurück, da wir diese gut kennen, hierzu bereits Material vorliegt und sie selbstverständlich immer ihre Berechtigung im Deutschunterricht haben. Zudem ist es natürlich gar nicht so einfach, sich im Berufsalltag in Frankreich über aktuelle Trends und Entwicklungen in Deutschland auf dem Laufenden zu halten.
Genau hier setzt unsere neue Webinar-Reihe als Kooperationsprojekt der Goethe-Institute in Frankreich und des DAAD Frankreich an: Einmal pro Monat, können Sie sich in einer Stunde darüber informieren und darüber austauschen, wie sich deutsche Kultur gegenwärtig entwickelt und was Menschen in Deutschland gerade bewegt. Aus den kurzen Input-Webinaren der DAAD-Lektorinnen und -Lektoren in Frankreich ergibt sich ein modernes und vielfältiges Deutschlandbild anhand dessen Sie neuen Schwung in Ihren Deutschunterricht bringen können.